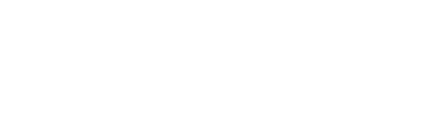Verschwörungstheorien haben es auch deswegen leicht, weil sie verblüffende Zusammenhänge herstellen. Statistisch oft belegbar, aber völlig absurd. So korreliert etwa der Fleischkonsum pro Kopf in den USA fast exakt mit der Zahl der Todesfälle durch Blitzschlag. Doch Korrelation ist eben etwas anderes als Kausalität. Das heißt im Umkehrschluss natürlich nicht, dass es erwiesene kausale Zusammenhänge zwischen zwei Phänomenen nicht gäbe. Womit wir bei den Medien, genauer: bei der Lokalpresse wären. Dieser wenig glamouröse Teil der Branche stand und steht immer im Schatten der großen nationalen und internationalen Blätter, wo sich leitartikelnde Wolkenschieber mit den – zweifellos bedeutsamen – Themen beschäftigen. Während die kleinen Lokalgazetten über Ausschusssitzungen des Gemeinderats, Nachbarschaftsstreit und örtliche Sportereignisse berichten.
Der fundamentale Beitrag lokaler Presse für das Gemeinwesen, für das demokratische Miteinander, wurde lange unterschätzt. Populisten sind dort besonders erfolgreich, wo es keine lokale Tageszeitung mehr gibt.
Doch lange unterschätzt wurde ihr fundamentaler Beitrag für das Gemeinwesen, für das demokratische Miteinander. Inzwischen gibt es einschlägige Untersuchungen in den USA und erstmals auch in Deutschland, die einen Verdacht wissenschaftlich untermauern: Nämlich den Umstand, dass Populisten dort besonders erfolgreich sind, wo es keine lokale Tageszeitung mehr gibt. Das hat Trump schon 2016 den Weg ins Weiße Haus geebnet, jetzt helfen solche Nachrichtenwüsten rechtspopulistischen Parteien in Deutschland. Keine Lokalzeitung bedeutet mehr AfD. Wie das?
Die bisweilen unterschätzte Funktion der Zeitung vor Ort, so zeigt eine Medienanalyse für Baden-Württemberg, macht Themen einer Kommune erst sichtbar, verbindet Menschen mit ihrem Nahbereich und trägt zur politischen Bildung bei, auch durch das Aufdecken von Korruption und Skandalen. Hier sind die Fakten im Zweifel von jedem oder jeder nachprüfbar. Fake News haben es erheblich schwerer. Die Tageszeitung ist das Forum, in dem Positionen präsentiert und Kompromisse ausgehandelt werden, kurz: wo Demokratie eingeübt und praktiziert wird.
Das zumindest ist die Idealbeschreibung, im Alltag hängt die Latte etwas tiefer. Doch wo die Blätter ganz verschwunden sind, erodiert das Vertrauen in das politische System, gewinnen obskure, nicht überprüfte Informationsquellen an Gewicht, fühlen Menschen sich von der Gesellschaft ausgeschlossen und fürchten um ihren Status – der ideale Nährboden für extremistische Verführer.
Nun gibt es handfeste Gründe für das Zeitungssterben, auch verlegerische. Nostalgisches Bedauern ist da keine Lösung. Aber es fehlt an einem intensiven öffentlichen Nachdenken darüber, wie diese demokratiegefährdende Lücke wieder geschlossen werden kann. Ehrenamtliche Informationsangebote wie lokale Blogs können das nicht, bestenfalls ergänzen sie. Aber eine offene, liberale Demokratie braucht den Sauerstoff eines professionellen Lokaljournalismus.