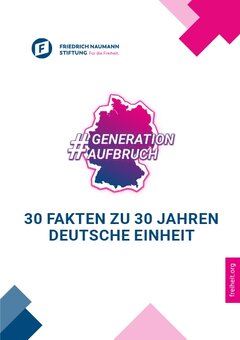Jahresbericht Deutsche Einheit
Ost-West-Stadt-Land-Spaltung?

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider stellte am Mittwoch den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit 2023 vor
© picture alliance / Flashpic | Jens KrickNächste Woche jährt sich die Deutsche Einheit zum 33. Mal. Zu diesem Anlass hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider (SPD) bereits diese Woche den neuen Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgestellt.
Auch im Jahr 2023 dreht sich die öffentliche Berichterstattung um altbekannte Kennzahlen: Das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner lag im vergangenen Jahr in Ostdeutschland bei 79 Prozent des Wertes im Westen. Beschäftigte im Osten verdienten im Durchschnitt etwa 13.000 Euro weniger als im Westen. Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt um 1,7 Prozentpunkte über dem West-Niveau. Der Bericht macht also klar, dass noch immer signifikante Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern bestehen – auch wenn der Aufholprozess des Ostens mehr als beachtlich ist.
Allerdings setzt der Bericht dieses Jahr einen etwas anderen Fokus. Statt ausschließlich Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu betrachten, geht die Analyse auch auf Unterschiede zwischen Stadt und Land ein. Und tatsächlich: Die strukturellen Gegebenheiten in urbanen und ländlichen Gegenden sind für die Lebensumstände oftmals genauso prägend wie Unterschiede zwischen West und Ost. Unabhängig von der Himmelsrichtung existieren in Deutschland boomende Metropolen, genauso wie strukturschwache Räume.
Auch die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit hat sich in diesem Jahr mit der Entwicklung urbaner und ländlicher Räume befasst. Feststeht: Städtische und ländliche Regionen sind und waren schon immer unterschiedlich. Zum Glück! Denn auch die Menschen sind verschieden und haben unterschiedliche Vorlieben bei ihrer Wahl des Wohnorts. Einige bevorzugen das städtische Chaos, andere die ländliche Ruhe.
Doch es ist sehr wohl ein Problem, wenn die Unterschiede zwischen Stadt und Land zu groß werden und der ländliche Raum aufgrund der schlechten Voraussetzungen nicht mehr als Wohnort in Betracht gezogen wird. Kommt es erst einmal zu einem Abwanderungsprozess, dann lässt sich dieser Teufelskreis aus sinkenden Steuereinnahmen, immer schlechter werdender Infrastruktur und (in der Folge) weiterer Abwanderung nur schwer aufhalten. In diesem Fall droht tatsächlich die Spaltung zwischen Stadt und Land.
Aussichtslos ist die Situation aber keineswegs. Die derzeitige Revolution der Arbeitswelt mit einem Aufstieg des mobilen Arbeitens schafft für den ländlichen Raum neue Perspektiven, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren. So könnte der ländliche Raum zum neuen Gründungshotspot werden, der das Arbeiten im Grünen ermöglicht und den Traum vom Eigenheim für mehr Menschen Realität werden lässt.
Damit es nicht nur beim Traum bleibt, braucht es eine bessere digitale Infrastruktur auch abseits der Speckgürtel, einen Abbau unnötiger Bürokratie, eine moderne Verkehrsinfrastruktur, um Stadt und Land optimal zu verbinden, eine serviceorientierte Verwaltung und eine Politik, die den Erwerb von Wohneigentum unterstützt sowie dem ländlichen Raum notwendige Freiheiten zugesteht. Auf diese Weise wäre ein starker ländlicher Raum auch eine Chance für die überlasteten Städte, die mit wachsendem Verkehrsaufkommen und steigenden Mieten zu kämpfen haben.
Es geht darum, das grundgesetzlich verankerte Postulat gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht aus den Augen zu verlieren. Stadt und Land müssen nicht gleich sein – genauso wenig wie Ost und West. Im Gegenteil: Dies wäre vor dem Hintergrund unterschiedlicher Wohn- und Lebenspräferenzen der Menschen gar nicht wünschenswert. Aber es muss gewährleistet sein, dass jede und jeder dort wohnen kann, wo es ihr bzw. ihm am besten gefällt. Egal ob in der Stadt, auf dem Land, im Osten oder im Westen.