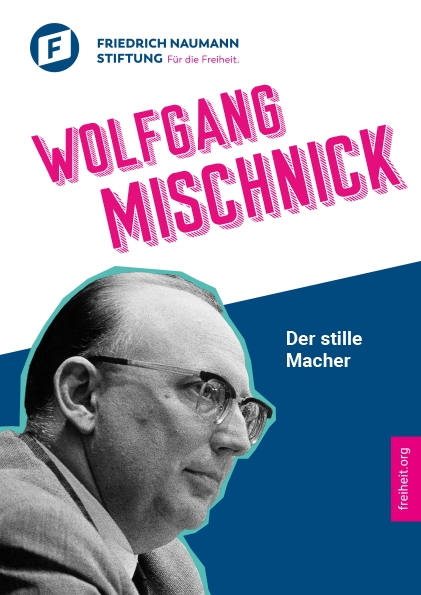Jubiläum
Wolfgang Mischnick
Wolfgang Mischnick war Zeit seines Lebens ein liberaler Brückenbauer. Nach dem Mauerfall nahm er eine Schlüsselrolle beim Neuaufbau der liberalen politischen Kräfte in der DDR ein. Als Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung wirkte er schließlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Zu seinem 100. Geburtstag erinnern wir an den entschlossenen Liberalen und Mittelsmann zwischen Ost und West.
Inhalt
- Ein entschlossener Liberaler
- > Der Politik verpflichtet
- > Kindheit, Jugend und Krieg
- Frühe Prägungen
- > Politische Anfänge im Osten
- > Der Neubeginn im Westen
- Politischer Aufstieg eines Flüchtlings
- > Der Sozialpolitiker
- > Der gesamtdeutsche Dialog
- Überwinder von Gegensätzen
- > Weichenstellungen
- > Stütze der Sozialliberalen Koalition
- > Der stille Macher
- Handeln aus Verantwortung
- > Die neue Koalition
- > Mittelsmann zwischen Ost und West
- Für Einheit und Freiheit
- > Die Wiedervereinigung
- > Ein liberaler Vermittler - in Deutschland und Europa
This is an excerpt from our publication, which you can order and download in our shop.
Ein entschlossener Liberaler

> Der Politik verpflichtet
Im Mai 1945 fand mit der Kapitulation des Deutschen Reichs der Zweite Weltkrieg in Europa ein Ende. Der Soldat Wolfgang Mischnick kehrte in seine Heimatstadt Dresden zurück. Nicht nur die Stadt, auch er selbst war von den zurückliegenden Jahren gezeichnet. Aus der Erfahrung des Kriegs und der Zerstörung zog er die klare Konsequenz, dass sich dies nicht wiederholen dürfe. Er empfand es deshalb als seine Pflicht, am Aufbau einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft mitzuwirken.
Es war ein Entschluss zur Politik, der Mischnick zunächst zur Mitarbeit in der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) Sachsens bewegte. Nach seiner Flucht in den Westen setzte er seine politische Tätigkeit in der FDP fort. Sein weiterer Weg führte ihn von der Kommunal-, über die Landes- bis hin zur Bundespolitik. Die vielleicht wichtigste politische Rolle fand Mischnick ab 1968 als Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Es war ein Amt, das er über zwanzig Jahre bekleiden sollte und in dem er die bundesdeutsche Politik entscheidend mitgestaltete. Mischnick machte sich einen Namen als Vermittler, als ein Mann des Ausgleichs und des Dialogs – auch in der Deutschlandpolitik. Trotz mancher Rückschläge trug er über Jahrzehnte unermüdlich dazu bei, dass der Gesprächsfaden zwischen Ost und West nicht abriss. Nur auf diese Weise, so seine Überzeugung, ließ sich der Frieden bewahren und – irgendwann vielleicht – die Wiedervereinigung erreichen. Mit der deutsch-deutschen Vereinigung des Jahres 1990 erfüllte sich schließlich sein politischer Lebenstraum.
> Kindheit, Jugend und Krieg
Wolfgang Mischnick wurde am 29. September 1921 als einziges Kind von Marie und Walter Mischnick in Dresden geboren und wuchs in einem bürgerlichen Haushalt auf. Der Vater arbeitete als Zivilangestellter in der Verwaltung der königlich-sächsischen Armee, während die Großeltern einen kleinen Gemischtwarenladen betrieben. Sein Elternhaus beschrieb Mischnick später als wenig politisch. In Dresden-Neustadt besuchte Mischnick das humanistische Staatsgymnasium, an dem auch nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ein vergleichsweise offener Geist geherrscht habe. Für die neue Diktatur konnte sich der Jugendliche kaum begeistern. Als er in die Hitlerjugend eintreten musste, sei er nur „ziemlich lustlos dabei“ gewesen. Auch danach blieb Mischnicks Leben und Denken relativ unberührt von den grundstürzenden politischen Veränderungen, die Deutschland und schließlich die Welt erfassten.
Der Jugendliche träumte davon, Flugingenieur zu werden und später seinen Doktor in den Staatswissenschaften zu machen. Es kam jedoch anders. Direkt von der Schulbank wurde der gerade 18-Jährige kurz nach Kriegsausbruch Ende 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Den Abschluss erhielt er nur noch in Form eines „Notabiturs“.
Mischnick wurde einer Artillerieabteilung zugeteilt, die zunächst in Frankreich stationiert war und dann in Russland kämpfte. Seit seiner schweren Verwundung im Gesicht 1944 musste er einen Stahlgaumen tragen. Als der Krieg im folgenden Jahr endete, hatte er rund ein Viertel seines jungen Lebens an der Front verbracht.
Frühe Prägungen

> Politische Anfänge im Osten
Als Mischnick nach Kriegsende in Dresden ankam, war völlig ungewiss, wie seine Zukunft aussehen würde. Da er Offizier der Wehrmacht gewesen war und aus bürgerlichen Verhältnissen stammte, hatte er keinen leichten Stand in der sowjetischen Besatzungszone. Auf dem Arbeitsamt wurde er sogleich bedrängt, der Kommunistischen Partei beizutreten, doch war Mischnick skeptisch gegenüber den Versprechungen des Kommunismus. Nach gründlicher Durchsicht der Parteiprogramme entschied er sich noch im August 1945, Mitglied der Liberal-Demokratischen Partei zu werden. Die Partei war kurz zuvor von den beiden ehemaligen Reichsministern Wilhelm Külz und Eugen Schiffer als Fortsetzung der bis 1933 bestehenden linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei gegründet worden. Zunächst war Mischnick zuversichtlich, dass man auch in der Sowjetischen Besatzungszone eine freie, demokratische Ordnung aufbauen könne. Bereits kurz nach Mischnicks Parteieintritt erkannte der sächsische LDP-Generalsekretär Ernst Mayer das politische Talent des jungen Mannes und förderte ihn nach Kräften. Mayer war überzeugter Demokrat und deshalb schon im „Dritten Reich“ angeeckt. Nun machte er sich an den Aufbau der liberal-demokratischen Landesorganisation, wobei ihn Mischnick als hauptamtlicher Jugendreferent unterstützen sollte. Gerne nahm dieser das Angebot an, das ihn nicht nur mit der politischen Arbeit in Berührung brachte, sondern ihm auch ein gewisses Auskommen sicherte.
Mischnick war in seinem Element. In seiner ersten Rede, die er auf einer LDP-Kundgebung vor großem Publikum hielt, beschwor er die desillusionierte Jugend, an der Begründung eines demokratischen Staats mitzuwirken. Sein Einsatz und sein Organisationstalent zeigten Wirkung. Trotz der schwierigen Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit ging der Aufbau der Partei voran. Aufgrund seiner Fähigkeiten beauftragte Mayer ihn schließlich auch mit der Organisation von Stadtteilgemeinschaften in Dresden-Neustadt und von einzelnen Ortsgemeinschaften.
Schnell stieg Mischnick in weitere Ämter und Funktionen auf. Bei den Kommunalwahlen 1946 wurde er zum Dresdner Stadtverordneten gewählt und etwa zur selben Zeit bestimmte ihn die Partei zum
Repräsentanten der Jugend im Landesvorstand sowie zum Zentralvorstandsmitglied. Im Ausschuss der Blockparteien übernahm er zudem die Geschäftsführung für die LDP. In dieser Funktion war Mischnick bemüht, Vereinnahmungsversuche durch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) abzuwehren, die von der Besatzungsmacht systematisch zur dominierenden politischen Kraft aufgebaut wurde.
Seine forsche und trotzige Art brachten ihn immer stärker in Konflikt mit den Obrigkeiten, aber trotz aller Widerstände nutzte er weiterhin geschickt und mit Mut den zunehmend kleiner werdenden politischen Handlungsspielraum.
> Der Neubeginn im Westen
Die Lage in der Sowjetischen Besatzungszone wurde für Mischnick immer heikler. Trotzdem lehnte er das Angebot Mayers ab, ihn nach Württemberg zu begleiten und dort für die liberale Demokratische Volkspartei (DVP) zu arbeiten. Er fühlte sich nach wie vor seiner sächsischen Heimat verpflichtet. Allerdings war an eine freie politische Betäti gung kaum mehr zu denken. Wegen seiner Kritik an der Jugendorganisation der SED, der Freien Deutschen Jugend (FDJ), strich ihn im Oktober 1946 die Sowjetische Militäradministration von der LDP-Liste zur Landtagswahl. Ein Jahr später wählte ihn der Landesparteitag zum stellvertretenden Landesvorsitzenden, allerdings wurde er als einziges Mitglied des neuen Vorstands nicht von der Besatzungsmacht bestätigt. Bald folgten ein Rede- und ein Schreibverbot sowie seine Entlassung als Jugendreferent und als LDP-Vertreter im Blockausschuss.
Als Mischnick im März 1948 bei einem Verhör unverhohlen gedroht wurde und ihn anschließend die deutliche Warnung erreichte, dass die Besatzungsmacht konsequenter gegen ihn vorgehen wolle, entschloss er sich endlich zur Flucht.Zunächst reiste er nach West-Berlin, um anschließend mit einem amerikanischen Flugzeug nach Frankfurt am Main zu gelangen. Bereits kurze Zeit später setzte in der Sowjetischen Besatzungszone, aus der 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) hervorging, eine Verhaftungswelle unter liberalen Jungpolitikern ein.
In Frankfurt musste sich Mischnick beruflich neuorientieren. Als Jugendreferent bei der hessischen LDP, der er unmittelbar nach seiner Flucht beigetreten war, konnte er seine parteipolitische Arbeit zunächst fortsetzen, doch wurde er schon nach kurzer Zeit wegen der wirtschaftlichen Folgen der Währungsreform wieder entlassen. Mischnick versuchte sich daraufhin, als Vertreter von Lötkolben und Versicherungen mehr schlecht als recht über Wasser zu halten. Auch als freier Journalist probierte er sein Glück.
Politisch lief es für Mischnick deutlich besser. Als im Dezember 1948 die Freie Demokratische Partei (FDP) in Heppenheim gegründet wurde, nahm er als Vertreter der Jungdemokraten an diesem parteipolitischen Zusammenschluss der westdeutschen Liberalen teil. Im Jahr darauf bewarb er sich um ein Mandat im Deutschen Bundestag und stellte im Wahlkampf die deutsche Wiedervereinigung in den Mittelpunkt. Zwar kam Mischnick, wie auch vier Jahre später, nicht zum Zuge, doch gelang ihm 1954 der politische Durchbruch: Er zog als Abgeordneter in den Hessischen Landtag ein, wurde Bundesvorsitzender der liberalen Jungdemokraten und damit Mitglied des FDP-Bundesvorstands. Mischnick war damit in wichtige Ämter gelangt, ohne aber die Belange seiner neuen Heimatstadt Frankfurt aus den Augen zu verlieren, wo er mit Unterbrechungen ab 1956 fast zwanzig Jahre lang als Kommunalpolitiker aktiv war.
Politischer Aufstieg eines Flüchtlings

> Der Sozialpolitiker
Im dritten Anlauf gelang es Mischnick schließlich 1957, Mitglied des Deutschen Bundestags zu werden. Er machte sich in der Fraktion schnell einen Namen als Experte für Sozialpolitik, die in der Nachkriegszeit angesichts zahlloser Witwen, Waisen, Vertriebener und Kriegsversehrter von besonderer Bedeutung war.
In den Wahlen 1961 fuhr die FDP ein hervorragendes Ergebnis ein. Die Koalitionsverhandlungen mit der Union verliefen wegen des Ringens um eine weitere Amtszeit von Bundeskanzler Konrad Adenauer zäh, aber am Ende erfolgreich. Für Mischnick, der seit 1959 Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion war, bedeutete die erneute Regierungsbeteiligung der FDP eine Herausforderung ganz neuer Qualität. Als Minister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte wurde er mit vierzig Jahren das jüngste Mitglied des neuen Kabinetts.
Mischnick setzte sich als Minister beispielsweise für bessere Versorgungsansprüche der Flüchtlinge aus der sowjetischen Besatzungszone ein, deren Schicksal er aus persönlicher Erfahrung gut kannte. Als nunmehr führender Sozialpolitiker seiner Partei versuchte er zugleich, die offenkundigen Defizite der Rentenreform von 1957 abzustellen, indem er als Vorsitzender einer Parteikommission einen Gegenentwurf entwickelte. Das als „Mischnick-Plan“ bekannt gewordene Rentenkonzept stellte er 1963 auf dem Bundesparteitag der FDP in München vor. Es enthielt mit der Forderung nach einer Stärkung der privaten Altersvorsorge Punkte, die bis heute eine wichtige Rolle in der Rentendebatte spielen.
Nach 14 Jahren Kanzlerschaft trat Adenauer im Herbst 1963 zurück. Diese Entscheidung blieb nicht ohne Folgen für Mischnick, denn dem Kabinett, das der neue Kanzler Ludwig Erhard bildete, sollte der FDP-Vorsitzende Erich Mende angehören. Mischnick räumte deswegen nach nur zwei Jahren im Amt für Mende seinen Ministerstuhl und wurde stattdessen stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Es war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass er freiwillig zugunsten anderer zurücksteckte. Für Mischnick sei ein solches Verhalten selbstverständlich gewesen, meinte später Hans-Dietrich Genscher und erklärte mit dieser Selbstlosigkeit einen Teil der Wertschätzung, die der scheidende Minister weit über die FDP hinaus genoss.
> Der gesamtdeutsche Dialog
Seit seiner Flucht nach Westdeutschland hatte Mischnick die Kontakte in Richtung Osten nie abreißen lassen. Er war überzeugt davon, dass der politische und persönliche Austausch zwischen den Menschen dies- und jenseits des Eisernen Vorhangs nicht aufhören dürfe, wenn das Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschen fortbestehen und der Frieden in Europa erhalten bleiben sollten. Früh hatte sich Mischnick deshalb für Gespräche zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion eingesetzt. Im Vertrauen auf die Wirkung des Dialogs reiste er 1959 auch zur Konferenz der Internationalen Parlamentarischen Union nach Warschau. Dort nutzte er die Gelegenheit, um mit Politikern aus den sozialistischen Ländern ins Gespräch zu kommen und sich für eine Verbesserung des polnisch-deutschen Verhältnisses einzusetzen. Mit der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD), wie die LDP seit 1951 hieß, gab es in der DDR einen natürlichen Ansprechpartner für die FDP. Immerhin hatten beide Parteien 1947/48 eine gemeinsame Dachorganisation unter dem Namen Demokratische Partei Deutschlands (DPD) gebildet und zudem waren zahlreiche ehemalige LDP(D)-Mitglieder wie Mischnick in der FDP aktiv. Obwohl die LDPD in den Jahren nach seiner Flucht vollständig politisch gleichgeschaltet wurde und über so gut wie keinen eigenen Spielraum mehr verfügte, konnten sich zumindest an ihrer Basis Reste liberalen Denkens behaupten. Mischnick trat trotz aller Hindernisse für den Dialog zwischen den Parteien ein. 1966 nutzte er die Möglichkeit, um gemeinsam mit der LDPD Akzente zu setzen. Auf Einladung der Jungdemokraten kamen Liberaldemokraten aus Erfurt ins hessische Bad Homburg, um hier über Fragen der Deutschlandpolitik zu diskutieren. Kurzentschlossen nahm Mischnick an dem Treffen teil. Durch diesen Schritt Mischnicks, der zu diesem Zeitpunkt Bundesminister a. D. und stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender war, erhielt der Bad Homburger Disput unversehens den Charakter eines Spitzentreffens. Zusammen mit den Teilnehmern der FDP bekannten sich die LDPD-Vertreter bei dieser Gelegenheit unumwunden zum Ziel der deutschen Einheit und zu gesamtdeutschen Wahlen. Diese Freimütigkeit missfiel der politischen Führung der DDR jedoch in einem solchen Maße, dass sie weitere Kontakte dieser Art untersagte. Mischnicks wiederholte Versuche, den Gesprächsfaden wiederaufzunehmen, blieben dementsprechend vorerst erfolglos.
Überwinder von Gegensätzen

> Weichenstellungen
Der Dialog zwischen Ost und West war in der Bundesrepublik alles andere als unumstritten. Eine schwere Hypothek für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten stellte nicht zuletzt der Bau der Berliner Mauer im August 1961 dar. Die Passivität, welche die westlichen Verbündeten in dieser Krise zeigten, geißelte Mischnick auf einer Versammlung von rund 10.000 Menschen auf dem Frankfurter Römer. Dabei handelte er entgegen seinem sonstigen Naturell recht impulsiv und blendete die geopolitischen Verhältnisse aus.
Der Mauerbau machte für einige in der FDP deutlich, dass es mit den alten außenpolitischen Rezepten keine Fortschritte geben würde. Seit den 1950er Jahren wurden in der Partei verschiedene Konzepte für eine andere Deutschlandpolitik entworfen, doch waren solche Ideen in der FDP mit ihrem starken nationalliberalen Flügel vorerst nicht mehrheitsfähig. Mischnick war zwar kein vorbehaltloser Unterstützer von Reformern wie etwa Wolfgang Schollwer, der die Anerkennung der DDR als Staat und den definitiven Verzicht auf die Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie empfahl, aber ihm war klar, dass eine rein konfrontative Politik keine Zukunft haben konnte.
Mit der Bildung der Großen Koalition zwischen CDU/CSU und SPD im Jahr 1966 begann für die FDP eine Zeit der Opposition, die sie zur inneren Neuausrichtung nutzte. Immer deutlicher setzten sich neue innen- und außenpolitische Vorstellungen durch. Das Jahr 1968 markierte schließlich einen entscheidenden Erfolg des Reformlagers.
Auf dem Bundesparteitag in Freiburg wurde mit Walter Scheel ein reformfreudiger Nachfolger für den eher nationalliberalen Bundesvorsitzenden Erich Mende gewählt. Zu Scheels Stellvertreter wurde neben Mischnick auch Hans-Dietrich Genscher bestimmt.
Auch in der FDP-Bundestagsfraktion standen die Zeichen auf Wandel. Noch kurz vor dem Freiburger Parteitag hatten die Parlamentarier Mischnick zu ihrem Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Knut von Kühlmann-Stumm gewählt, der ein Gegner des neuen Kurses war. Künftig sollte Mischnick zusammen mit Scheel und Genscher das Führungstrio der FDP bilden. Bis 1991 behielt er das Vertrauen der Fraktion und das Amt, das er später nicht einmal gegen einen Ministerposten eintauschen wollte. Als Fraktionsvorsitzender prägte er die freidemokratische Politik im Bundestag über mehr als zwei Jahrzehnte und sorgte für eine Balance zwischen den Fraktionsflügeln.
> Stütze der Sozialliberalen Koalition
Die Reformstimmung in der FDP warf die Frage auf, welche der beiden Volksparteien künftig der geeignetere Koalitionspartner sein würde. Der sozialliberale Geist, der in der FDP Einzug gehalten hatte, machte eine Koalition mit den Sozialdemokraten auf Bundesebene zu einer durchaus möglichen Variante. Erst recht, da sich auch in der SPD seit Beginn der 1960er Jahre Anschauungen von einer neuen Deutschland- und Außenpolitik durchgesetzt hatten, die sich in der griffigen Formel „Wandel durch Annäherung“ verdichteten.
Aus der Bundestagswahl 1969 ging die CDU/CSU als stärkste Kraft hervor, aber es gab auch eine Mehrheit für eine Koalition von SPD und FDP. Scheel strebte ein solches sozialliberales Bündnis konsequent an und konnte sich dabei der Unterstützung Mischnicks gewiss sein. Die Bundestagsfraktion folgte dem Kurs des Bundesvorsitzenden, so dass Willy Brandt mit einer Mehrheit von SPD und FDP zum Kanzler gewählt und die bundespolitische Dauerherrschaft der Union beendet wurde.
Die Sozialliberale Koalition markiert eine Zäsur in der bundesdeutschen Geschichte. Getragen vom Fortschrittsoptimismus der Zeit gingen die neuen Bündnispartner mit viel Eifer ans Werk, um Reformen in Gang zu setzen, welche Staat und Gesellschaft nachhaltig verändern sollten: Die Liberalisierung des Ehe- und Familienrechts, die Erweiterung des Sozialstaats und der Ausbau des Bildungswesens sind nur ein paar Beispiele für diese Politik der Zukunft.
Den wichtigsten inhaltlichen Kitt der Sozialliberalen Koalition bildete aber die „Neue Ostpolitik“, die eine Normalisierung und Entspannung im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und ihren östlichen Nachbarn zum Ziel hatte. Gedanklicher Ausgangspunkt war die Bereitschaft zur Anerkennung des Status quo, insbesondere der Grenzziehung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Mischnick unterstützte entschieden die pragmatische und vernunftorientierte „Neue Ostpolitik“, versprach er sich doch von ihr auch humanitäre Verbesserungen für die Menschen in der DDR. Er betrachtete die Ostverträge, welche die Bundesrepublik während der Kanzlerschaft von Willy Brandt mit den Staaten des Ostblocks schloss, als „wichtige Zwischenetappe zu mehr Vernunft, zu mehr Nachbarschaft und zu mehr Verständigung in Deutschland“. In der FDP-Bundestagsfraktion sahen dies jedoch zunächst nicht alle so. Der Verzicht auf die ehemals deutschen Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie oder die staatliche Anerkennung der DDR waren für manchen Abgeordneten ein Sakrileg. Als 1970 gleich drei Abgeordnete die Fraktion aus Protest gegen die Politik der Sozialliberalen Koalition verließen, war die knappe parlamentarische Mehrheit von FDP und SPD ernsthaft bedroht.
Die Krise der FDP im Bundestag war eine Bewährungsprobe für ihren Fraktionsvorsitzenden Mischnick. Es gelang ihm schließlich, die Situation zu meistern und ein Auseinanderbrechen der Fraktion zu verhindern. Auf die Frage, welche Eigenschaften ein Fraktionsvorsitzender haben müsse, nannte Mischnick viele Jahre später: Geduld, die Bereitschaft, die Eigenständigkeit des Einzelnen zu respektieren und die Fähigkeit, sein Gegenüber überzeugen zu können. Mit dieser Mischung aus Empathie und Entschlossenheit schaffte es Mischnick, noch manche andere Herausforderung zu bewältigen.
> Der stille Macher
Das Magazin „Der Spiegel“ nannte Mischnick einmal einen „Magier der leisen Töne“. Als Fraktionsvorsitzender wirkte er oft eher im Hintergrund und trat weniger prominent hervor als etwa Scheel, Genscher oder Otto Graf Lambsdorff. Außerdem neigte er nicht zu theatralischen Auftritten. In der Deutschlandpolitik war er jedoch durchaus für Überraschungen gut, wenn er sich von ihnen Verbesserungen für die Menschen beiderseits der Grenze versprach.
So reiste Mischnick 1973 in die DDR, um sich dort mit dem LDPD-Vorsitzenden Manfred Gerlach auszutauschen. Bei der Begegnung versuchte Mischnick, um Vertrauen zu werben und auf intensivere Kontakte zwischen LDPD und FDP hinzuwirken. Auch problematische Themen wie den „Schießbefehl“ an der deutsch-deutschen Grenze sparte er nicht aus. Im Anschluss fuhr er zu einem Treffen mit SED-Generalsekretär Erich Honecker, das der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner arrangiert hatte. Zusammen mit Wehner bemühte sich Mischnick bei Honecker um die Entlassung politischer Häftlinge aus DDR-Gefängnissen und Familienzusammenführungen. Am Ende hatten die beiden Fraktionsvorsitzenden mit ihrer Aktion, die der Öffentlichkeit nicht verborgen blieb, auch Erfolg.
Handeln aus Verantwortung

> Die neue Koalition
Die Fraktionsvorsitzenden Wehner und Mischnick waren die tragenden Säulen der Sozialliberalen Koalition. Die beiden Dresdner respektierten und vertrauten einander. Sie sorgten auch unter der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt seit 1974, die von einer schlechten Weltwirtschaftslage und dem Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF) geprägt war, für Stabilität im Regierungsbündnis.
Nach der Bundestagswahl 1980 verlängerten FDP und SPD noch einmal ihre Zusammenarbeit, die sich jedoch immer schwieriger gestaltete. Unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die Wirtschaftskrise der Bundesrepublik in den Griff zu bekommen sei, und der mangelnde Rückhalt, den Schmidt in seiner eigenen Partei genoss, machten ein vorzeitiges Ende der politischen Partnerschaft zunehmend wahrscheinlich. Während manche wie der FDP-Parteivorsitzende und Außenminister Genscher früh mit dem Gedanken an ein Ende der Koalition spielten, versuchte Mischnick lange, das Bündnis zu bewahren.
In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage und einer sich verschärfenden politischen Krise im Zuge des NATO-Doppelbeschlusses kam allerdings auch Mischnick im Laufe des Jahres 1982 zu dem Ergebnis, dass die Fortsetzung der Sozialliberalen Koalition nicht mehr zu verantworten war. Zusammen mit Genscher, dessen enger Vertrauter er war, stand Mischnick nun vor der Herausforderung, den Wechsel zu einer Koalition mit der CDU/CSU zu bewerkstelligen.
Als Fraktionsvorsitzender war die Lage für ihn nicht einfach: Zahlreiche Abgeordnete der FDP lehnten die vorzeitige Beendigung der Koalition strikt ab. Schließlich stimmte aber eine deutliche Mehrheit der Fraktionsmitglieder am 1. Oktober 1982 bei einem Misstrauensvotum gegen Schmidt und für Helmut Kohl. Der Koalitionswechsel war damit vollzogen – ein Schritt, der Mischnick politisch wie menschlich nicht leichtfiel.
> Mittelsmann zwischen Ost und West
Die neue Koalition aus FDP und Union wahrte unter dem weiterhin amtierenden Außenminister Genscher die außen- und deutschlandpolitische Kontinuität. Weiterhin sollten Dialog, Annäherung und Entspannung das Verhältnis beider deutscher Staaten bestimmen. In diesem Sinne plädierte Mischnick 1983 im Bundestag dafür, die deutsch-deutschen Gespräche unbedingt fortzusetzen.
Eine wichtige Rolle kam dabei der FDP und der LDPD zu. Es gelang Mischnick in den 1980er Jahren, als zentraler Mittelsmann die Beziehungen zwischen beiden Parteien auf eine neue Stufe zu heben und damit zur politischen Entspannung beizutragen. Ein Zusammentreffen zwischen Mischnick und dem LDPD-Vorsitzenden Gerlach 1984 in Ost-Berlin – das erste seit über zehn Jahren – wurde zur Initialzündung weiterer Konsultationen und gegenseitiger Besuche von FDP- und LDPD-Politikern.
Eine vergleichsweise große Resonanz in Ost wie West fand die Teilnahme einer von Mischnick geführten FDP-Delegation am Parteitag der LDPD 1987 in Weimar. Es war seit seiner Flucht vor fast vierzig Jahren die erste LDP(D)-Veranstaltung, an der er teilnahm. In einer gemeinsamen Pressemitteilung betonten die Parteien die Bedeutung der Dialogpolitik, die einen Beitrag zur Friedenssicherung leiste. Genscher und Mischnick begrüßten darüber hinaus in einem Pressegespräch die Veränderungen, die der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow unter den Schlagwörtern „Glasnost“ und „Perestroika“ in der Sowjetunion angestoßen hatte. Solche Aussagen wurden in der DDR sensibel registriert.
Am Rande des Parteitags kam es zu einer erneuten Begegnung zwischen Honecker und Mischnick. Schon drei Jahre zuvor waren beide zu Gesprächen zusammengekommen, die Mischnick dazu genutzt hatte, um vor der Presse die Notwendigkeit einer europäischen Friedensordnung hervorzuheben.
Für Einheit und Freiheit

> Die Wiedervereinigung
Im Jahr 1989 offenbarten sich die inzwischen tiefen Risse im Fundament der SED-Herrschaft. Die Bevölkerung ging für Veränderungen auf die Straße und setzte damit die politische Führung zunehmend unter Druck. Als sich Mischnick Ende Oktober mit einigen FDP-Abgeordneten in Dresden aufhielt, lud ihn zu seiner Überraschung die neue SED-Führung zu einem Gespräch ein, in dessen Verlauf er erfuhr, dass alle Ostdeutschen bald frei reisen dürfen sollten. Mischnick war sofort klar, dass diese Ankündigung geradezu historisch war. Schon wenige Tage später sollte die Mauer fallen. Vor dem Bundestag zollte Mischnick der Bevölkerung der DDR Respekt für ihren Mut und ihre Entschlossenheit, die dies ermöglicht habe.
In den folgenden Monaten nahm Mischnick eine Schlüsselrolle beim Neuaufbau der liberalen politischen Kräfte in der DDR ein. Unter seiner Vermittlung gründeten die Liberaldemokraten zusammen mit zwei liberalen Neugründungen ein Wahlbündnis für die bevorstehenden Volkskammerwahlen, das den richtungweisenden Namen Bund Freier Demokraten (BFD) trug.
Mischnick genoss das Vertrauen aller drei Bündnispartner und wurde deshalb zum Vorsitzenden des Koordinierungsausschusses bestimmt, der sowohl die Unterstützung der FDP sichern als auch den Wahlkampf des BFD abstimmen sollte. Dabei gelang es ihm, die Interessen der Parteien, die sich im Selbstverständnis und in ihrer Struktur erheblich voneinander unterschieden, zum Ausgleich zu bringen.
Nach der Volkskammerwahl galten Mischnicks Bemühungen dem Zusammenschluss der liberalen Parteien des Ostens mit der FDP. Aus dem Koordinierungs- wurde unter seiner Leitung der Vereinigungsausschuss. Die größte Herausforderung dabei war es, den Sorgen der ostdeutschen Liberalen vor einer Vereinnahmung durch die FDP zu begegnen und gleichzeitig die Animositäten, welche die drei ostdeutschen liberalen Parteien untereinander hegten, zu entschärfen. Die Bemühungen waren schließlich von Erfolg gekrönt. Am 12. August 1990 glückte in Hannover die Vereinigung der Liberalen in Ost und West zu einer gesamtdeutschen FDP. Nur rund zwei Monate später folgte die Deutsche Einheit. Für Mischnick war damit ein Ziel erreicht, für das er sich seit seinem Eintritt in die Politik eingesetzt hatte
> Ein liberaler Vermittler - in Deutschland und Europa
Eigentlich hatte Mischnick beabsichtigt, seine politische Karriere mit der nächsten Bundestagswahl zu beenden. Angesichts der Wiedervereinigung sah er aber neue Herausforderungen auf das Land zukommen und entschloss sich mit fast siebzig Jahren zu einer erneuten Kandidatur. Der Bruch, der seine Biographie seit der Flucht vor über vierzig Jahren durchzogen hatte, wurde endlich überwunden, als er in den ersten gesamtdeutschen Bundestag als Abgeordneter über die sächsische Landesliste einzog. Unablässig setzte er sich in den folgenden Jahren für das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland ein. Noch in seiner letzten Rede im Bundestag 1994 betonte er, dass es jetzt darum gehe, „nicht nur die wirtschaftliche und die soziale, sondern auch die geistige Einheit herbeizuführen“.
Mischnick kämpfte nicht nur in seinen Ämtern in Partei und Fraktion für eine freie und demokratische Gesellschaft. Bereits 1987 hatte er den Vorsitz der Friedrich-Naumann-Stiftung übernommen, die ihre Aktivitäten in seiner Amtszeit noch einmal ausweitete. So unterstützte die Stiftung unter Mischnicks Vorsitz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs den zivilgesellschaftlichen Aufbau in den Ländern Mittel-, Südost- und Osteuropas und es entstanden neue Auslandsbüros in Ljubljana, Tallin und Moskau. Zugleich wurde die Bildungsarbeit auf Ostdeutschland ausgedehnt, wo Mischnick 1991 mit Gleichgesinnten in Meißen die Wilhelm-Külz-Stiftung gründete, die sich seitdem in Sachsen für freiheitliches Denken und Handeln einsetzt.
Wolfgang Mischnick war Zeit seines Lebens ein liberaler Brückenbauer. Sein politisches Handeln war nicht von blindem Ehrgeiz motiviert, sondern gründete in der tiefen Überzeugung, selbst einen Beitrag zur Verwirklichung der Ideale des Liberalismus leisten zu müssen. Dieses Pflichtempfinden ließ ihn oft das Rampenlicht meiden. Ihm kam es nicht auf das Spektakel, sondern auf das Ergebnis an. Als er am 6. Oktober 2002 im Alter von 81 Jahren in seiner hessischen Heimat verstarb, endete ein Leben für Freiheit und Demokratie