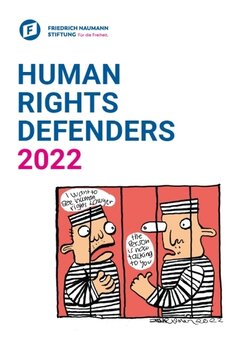Europäische Konvention
Ein Meilenstein beim Schutz der Anwaltschaft

Am 12. März 2025 wurde die Europäische Konvention zum Schutz des Anwaltsberufs einstimmig vom Ministerkomitee des Europarats verabschiedet. Dieses internationale Abkommen soll künftig die anwaltlichen Kernwerte und den Zugang zum Recht völkerrechtlich absichern. Die Konvention wird am 13. Mai zur Unterzeichnung bereitgestellt, im Rahmen des Treffens der Außenminister des Europarates in Luxemburg.
Der Rechtsberuf bildet das Fundament der Rechtsstaatlichkeit, indem er den Zugang zur Justiz sicherstellt, die Menschenrechte schützt und die öffentliche Gewalt kontrolliert. Dennoch sahen sich Anwältinnen und Anwälte in einigen Ländern in Europa, insbesondere in illiberalen und autoritären Regimen, zunehmenden Bedrohungen, wie Einschüchterung, willkürlicher Inhaftierung und sogar Ermordung ausgesetzt. Diese Entwicklungen machten die Schaffung eines verbindlichen internationalen Rechtsrahmens zum Schutz der Anwaltschaft unerlässlich.
Vor diesem Hintergrund begann der Europarat im Jahr 2022 mit der Ausarbeitung einer Europäischen Konvention über den Beruf des Rechtsanwalts. Diese Initiative zielte darauf ab, die Rechte und die Unabhängigkeit von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in den Mitgliedstaaten zu stärken und vor allem in Ländern mit eingeschränkter Rechtsstaatlichkeit einen effektiven Schutz zu gewährleisten.
Hauptbestimmungen und Implikationen
Die Konvention etabliert umfassende Schutzmaßnahmen für die Anwaltschaft, darunter Garantien für die Unabhängigkeit, den Schutz vor unzulässiger Einflussnahme und Sicherheiten gegen willkürliche Disziplinarverfahren. Ein zentrales Merkmal ist die ausdrückliche Verpflichtung der mitzeichnenden Staaten, sicherzustellen, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Tätigkeit frei und ohne Einschüchterung ausüben können (Art. 10). Diese Bestimmung ist besonders bedeutsam in Rechtsordnungen, in denen die Justiz beeinträchtigt oder politisch kontrolliert ist.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Regelung zur Vertraulichkeit und zum Anwaltsgeheimnis, die das Recht der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte stärken, ohne staatliche Überwachung mit ihren Mandantinnen und Mandanten zu kommunizieren (Art. 7). Diese Bestimmung stellt sich gegen drakonische Maßnahmen in autoritären Staaten, die nationale Sicherheitsgesetze als Vorwand nutzen, um juristische Berufsausübung zu überwachen oder zu verfolgen. Zudem stärkt die Konvention die Rolle der Anwaltskammern, indem sie deren Unabhängigkeit von staatlicher Einflussnahme betont. In Ländern wie der Türkei und Russland wurden staatlich kontrollierte Anwaltskammern dazu verwendet, Menschenrechtsanwältinnen und -anwälte sowie Regimekritikerinnen und -kritiker zu disziplinieren. Die Konvention zielt darauf ab, solche Praktiken zu unterbinden, indem sie vorschreibt, dass berufliche Rechtsgremien autonom arbeiten.
Umsetzungsherausforderungen und verbleibende Lücken
Obwohl die Konvention die Realität anerkennt, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte insbesondere in Konfliktgebieten und autoritären Staaten gefährdet sind (Artikel 3 & 7), fehlen spezifische Bestimmungen zur Sicherstellung schneller Reaktionsmechanismen für bedrohte Anwältinnen und Anwälte. Die Durchsetzung der Unabhängigkeit von Anwaltskammern bleibt in Staaten, in denen Regierungen starken Einfluss auf juristische Institutionen ausüben, eine erhebliche Herausforderung.
Die Verstärkung der Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant hängt von der nationalen Umsetzung ab. Zudem adressiert die Konvention den Schutz vor Angriffen durch nichtstaatliche Akteure, jedoch ohne verbindliche Verpflichtungen der Staaten, proaktive Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Das Fehlen eines gerichtlichen Durchsetzungsmechanismus schwächt die potenzielle Wirksamkeit der Konvention. Das Überwachungssystem, das am Prozess der Evaluierung durch die GRECO (Gruppe der Staaten gegen Korruption) orientiert ist, könnte politischen Druck ausüben, jedoch könnte ohne konkrete Durchsetzungsmaßnahmen ihr Einfluss begrenzt sein. Der Zugang zu Mandantinnen und Mandanten sowie Verfahren, insbesondere in politisch sensiblen Fällen, wie denen im Bereich Migration und Asyl, wird anerkannt, jedoch nicht umfassend geschützt, wie etwa die Schutzmaßnahmen für Anwältinnen und Anwälte, die im Exil leben.
Positiv hervorzuheben ist, dass die Konvention auch für Nicht-Mitgliedstaaten des Europarats offensteht, was ihr das Potenzial verleiht, einen globalen Standard für den rechtlichen Schutz des Anwaltsberufs zu setzen. Allerdings werfen die fehlenden klaren Mechanismen zur Sicherstellung der Einhaltung Fragen hinsichtlich ihrer globalen Wirkung auf.
Ausblick auf den rechtlichen Schutz in Europa
Der Erfolg der Konvention wird in den kommenden Jahren von der politischen Entschlossenheit und der aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft abhängen. Rechtsvertretungsorganisationen müssen auf eine rasche Ratifizierung und Umsetzung drängen und dabei regionale Menschenrechtsmechanismen nutzen, um Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Europäische Union kann eine ergänzende Rolle spielen, indem sie finanzielle Hilfen und Handelsabkommen an die Einhaltung des rechtlichen Schutzes für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte knüpft. Das Europäische Parlament hat bereits Interesse daran gezeigt, die Prinzipien der Konvention in seine Rechtsstaatsmechanismen zu integrieren.
Gleichzeitig muss die internationale Rechtsgemeinschaft wachsam gegenüber Bestrebungen bleiben, die Bestimmungen der Konvention zu verwässern. Die kommenden Jahre werden entscheidend dafür sein, ob dieses historische Abkommen tatsächlich einen Schutzschild für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte vor Repressionen bietet oder ob es ein symbolisches, aber letztlich wirkungsloses Rechtsinstrument bleibt.
Eine noch ausführlichere Analyse von Dr. Salim Amin finden Sie unter dem Titel "The New European Convention for the Protection of the Profession of Lawyer - A Milestone or a Missed Opportunity?" hier beim Völkerrechtsblog. Sie ist am 13. Mai 2025 erschienen.