§ 219a StGB
§ 219a StGB – besser gleich abschaffen
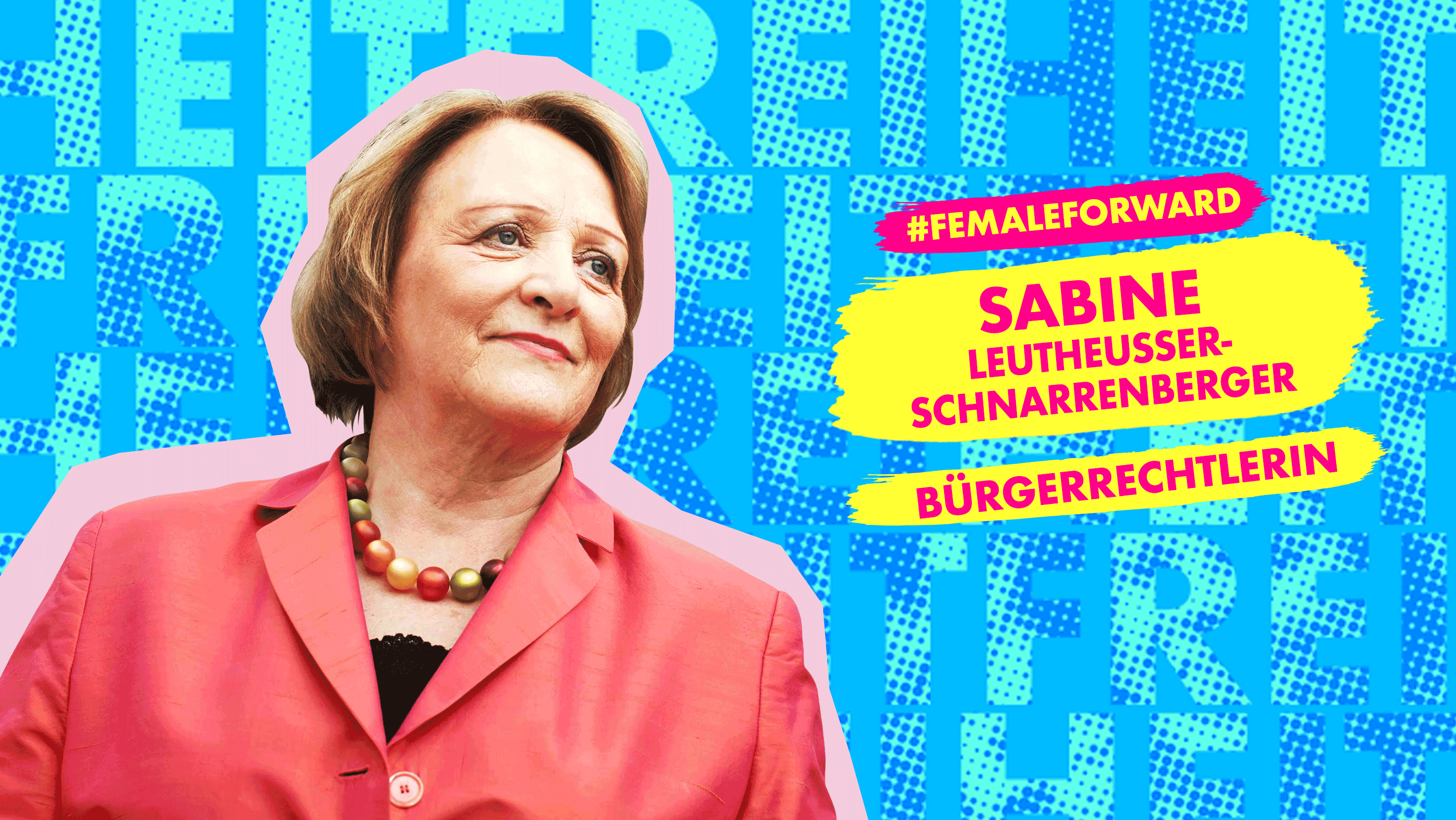
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
© TroNa GmbHDer Bundestag hat die umstrittene Änderung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche (§219a StGB) nun endgültig beschlossen. Das ist bedauerlich, denn die mit diesem Thema verbundenen Probleme und Konflikte werden sich so nicht lösen lassen. Die ganze Bandbreite der Kritik an der nun beschlossenen Reform zeigte sich zu Beginn der Woche in der bereits zweiten öffentlichen Anhörung zum Thema. Fast einmütig sprachen sich dabei vor allem die wissenschaftlichen Experten gegen den schwachen Kompromiss der Bundesregierung aus. Hiernach wird das strafrechtliche Werbeverbot aufrechterhalten und nur ein weiterer Ausnahmetatbestand eingefügt.
Die eingeladenen Rechtsexperten, Sozialwissenschaftler und Ärzte kritisierten dabei vor allem, dass die Reform zu kurz greife. Zwar wird das Informationsangebot für Frauen durchaus verbessert und zumindest das reine Informieren über die Durchführung von (legalen!) Schwangerschaftsabbrüchen von Strafandrohung befreit. Jede darüber hinausgehende Information bleibt für die Ärzte aber weiterhin strafbar. Eine zu Recht als widersprüchlich kritisierte Rechtslage, nach der weiterführende sachliche Informationen zum Schwangerschaftsabbruch nun durch öffentliche Stellen, etwa bei den Ärztekammern oder Beratungsstellen, legal und erwünscht, ausgesprochen durch Ärztinnen und Ärzte aber strafrechtlich sanktioniert werden.
Kaum zu überzeugen vermag auch die Ansicht, den Klagen der selbsternannten „Lebensschützer“ und „Babycaust“ Aktivisten sei nun die Basis entzogen. Vielmehr bleibt diese mit der Entscheidung für das Aufrechterhalten des strafrechtlichen Werbeverbotes in § 219a StGB ja gerade bestehen. Es bleibt zu befürchten, dass solche „Aktivisten“ nun noch genauer die Internetseiten und Informationsangebote der betreffenden Ärzte durchkämmen und beobachten, wo auch nur eine Silbe zu viel gesagt wird. Rechtssicherheit sieht anders aus und für den Schutz der Ärzte – eine Frage die viele Abgeordnete beschäftigte – ist damit zu wenig getan. Auch die beiden geladenen Ärzte, die ansonsten gegensätzlicher Meinung waren, stimmten hier überein und forderten Verbesserungen.
Schließlich wurden auch in verfassungsrechtlicher Hinsicht erneut viele Bedenken geäußert. Dabei werden, wie bereits zuvor, vor allem unverhältnismäßige Eingriffe in die Informationsfreiheit der betroffenen Frauen und in die Berufsfreiheit der Ärzte ins Felde geführt. Neben diesen berechtigten Bedenken warf aber vor allem der Hamburger Rechtsprofessor Merkel eine wichtige Frage auf: was darf der Staat eigentlich legitimerweise unter Strafe stellen? Wie in der bisherigen rechtspolitischen Debatte um § 219a StGB noch zu wenig diskutiert, darf der Gesetzgeber eben nicht jedes Verhalten beliebig unter Strafe stellen. Es gilt der Grundsatz, dass der Einsatz des Strafrechtes zur Normstabilisierung grundsätzlich nur ultima ratio sein darf. Zieht man ferner in Betracht, dass es Ärzten bereits durch das Wettbewerbsrecht (§ 3 Abs. 1 UWG) als auch das Standesrecht (§ 27 MBO-Ä) untersagt ist, sich unlauter geschäftlich zu verhalten und anpreisend, irreführend oder vergleichend zu werben, so scheint § 219a StGB doch ganz und gar überflüssig.
Vor diesem Hintergrund ist die Ankündigung der FDP-Fraktion, eine Überprüfung des § 219a StGB vor dem Verfassungsgericht anzustreben, zu begrüßen. Es bleibt zu hoffen, dass eine Klarstellung durch die Karlsruher Richter – etwa auch dahingehend, ob das Werbeverbot des § 219a StGB tatsächlich unentbehrlicher Bestandteil des verfassungsrechtlichen Schutzkonzeptes des ungeborenen Lebens ist – zur Befriedung der wieder zunehmend polarisierten gesellschaftlichen Debatte beiträgt. Die durch den Bundesgesundheitsminister Spahn geplante Studie zu den „psychologischen Folgen für Frauen durch Schwangerschaftsabbrüche“ droht ganz im Gegensatz dazu eher einen weiteren Keil in die Gesellschaft zu treiben.
