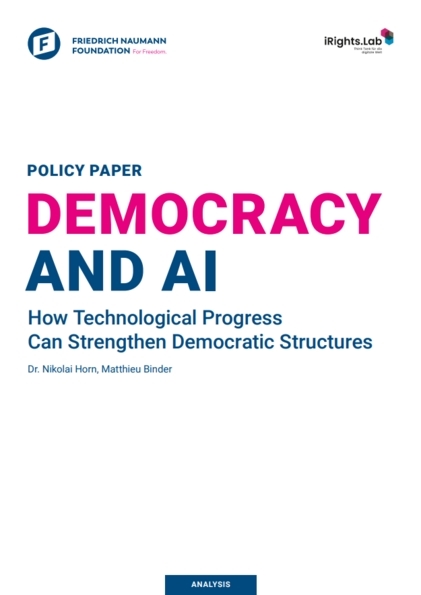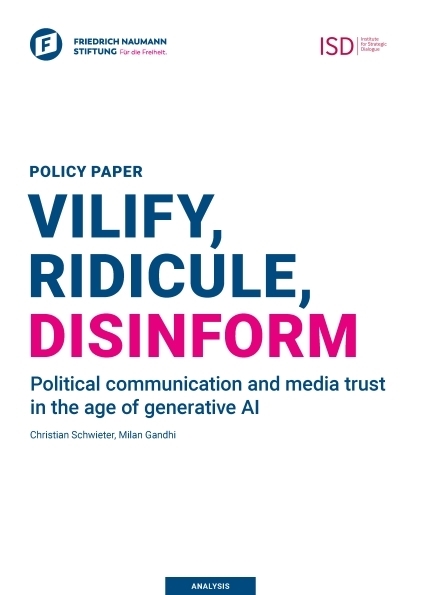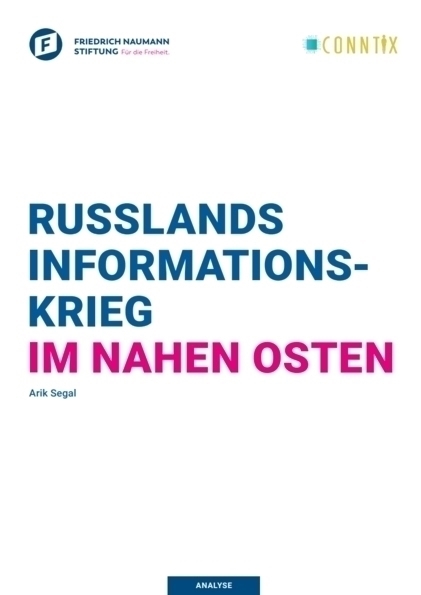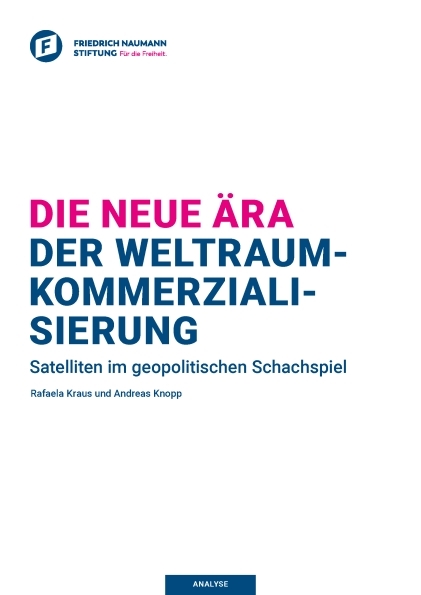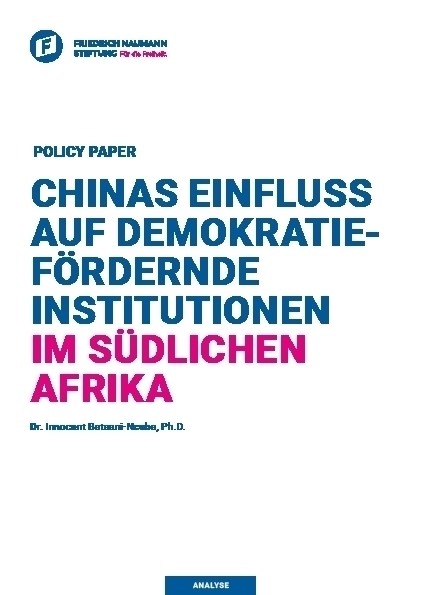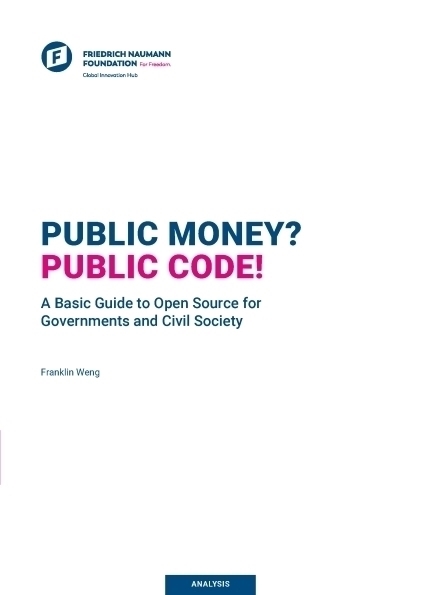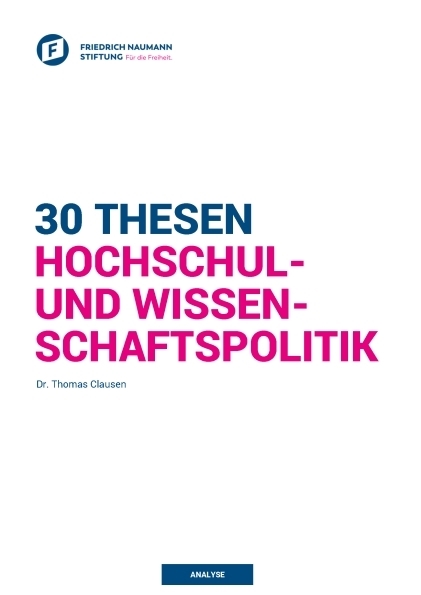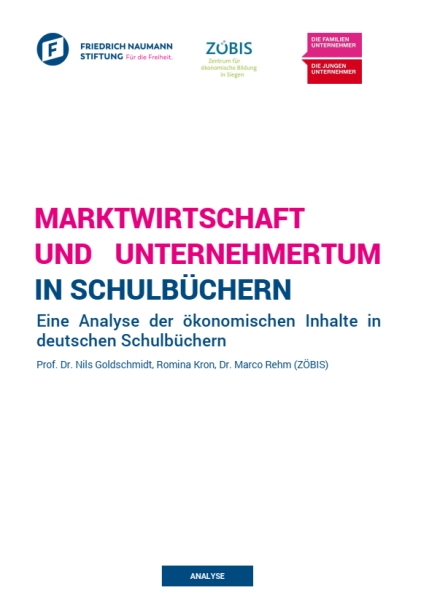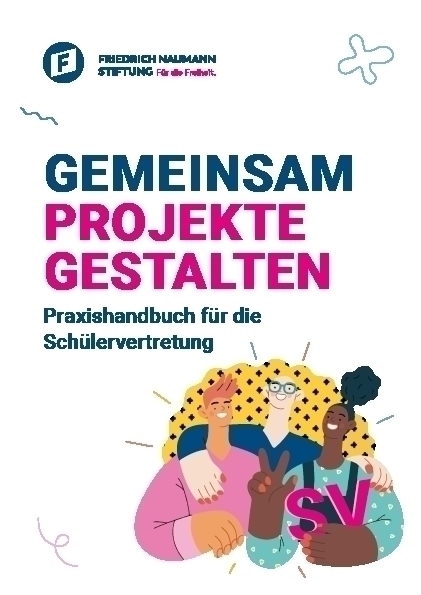re:publica
Demokratie und KI - Wie technologischer Fortschritt demokratische Strukturen stärken kann
Wie kann KI genutzt werden, um Demokratien resilienter zu machen? Dafür gibt es schon heute viele Beispiele weltweit. KI kann in allen demokratierelevanten Bereichen eingesetzt werden, doch gibt es auch Bedenken, die mitgedacht werden müssen. Genauso wie für die Freiheitsförderung kann sie auch für die Unterdrückung politisch unerwünschter Meinungsäußerungen oder zum politisch motivierten Scoring der Bevölkerung eingesetzt werden. Eine ausgewogene Betrachtung der KI-Potenziale für die Demokratie muss sich daher mit besonderen Aspekten der Demokratie als politischer Form der Freiheit befassen. Welche Potentiale hat der Einsatz von KI für die Demokratie? Das neue Gutachten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gibt über diese Fragen Aufschluss.
Demokratie und KI
Programm auf der re:publica 2024
SESSIONS
Montag, 27. Mai 2024 - Stage 3
15:00 bis 15:30 Uhr
Paneldiskussion
DemoKI: KI als Demokratieverstärker: Wege in eine klügere Zukunft
Jenseits von Bedrohungsszenarien und bloßem Optimismus diskutieren wir einen realistischen Weg wie KI unsere Demokratie stärken kann. Angesichts eines schwindenden Vertrauens in Demokratien weltweit stehen konkrete Potenziale von KI, die bereits jetzt global genutzt werden, im Fokus der Diskussion.
- Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ehemalige Justizministerin, Vorsitzende des Rats Agora Digitale Transformation und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Friedrich-Naumann Stiftung für die Freiheit
- Nikolai Horn, Autor der Studie "Demokratie und KI”
- Moderation: Ann Cathrin Riedel
Dienstag, 28. Mai 2024 - Lightningbox 2
15:30 bis 16:00 Uhr
Who cares for elections - Gen AI trifft Demokratie
Unter dem Slogan „Who cares for elections" beleuchten wir, wie generative KI gerade in Zeiten von Wahlen gezielt für Informationsmanipulation und Desinformation genutzt wird. Wie verändert sich politische Kommunikation, aber auch Vertrauen in Medien und Demokratie in diesem Superwahljahr weltweit?
- Richard Kuchta, Institute for Strategic Dialogue (ISD)
STANDPROGRAMM (Expo Area)
Montag, 27. Mai 2024
Talk am FNF-Stand
12:30 bis 12:45 Uhr
AI Alliances: Deutschlands Rolle im Hiroshima AI Process
mit Benjamin Brake, Abteilungsleiter für Digital- und Datenpolitik im BMVD
Montag, 27. Mai 2024
Q & A am FNF-Stand
12:30 bis 18:00 (ganztägig)
Stipendien für die Freiheit - Infos für Studierende, Promovierende und Auszubildende
Dienstag, 28. Mai 2024
Talk am FNF-Stand
10:00 bis 10:30 Uhr
Bildungsrepublik in der Betaversion?
mit Benno Schulz, Referent für Bildung und Wissenschaft
am Liberalen Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Dienstag, 28. Mai 2024
am BMDV-Stand (!)
14:00 bis 14:45 Uhr
Diskussionsrunde „Freiheit im digitalen Raum“
mit unserer Expertin Zoë van Doren, Referentin für Globale Digitalisierung & Innovation
bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Dienstag, 28. Mai 2024
am FNF-Stand
14:45 bis 15:15 Uhr
iRights.Lab: DemoKI - Wie kann KI unsere Demokratie stärken?
mit Matthieu Binder, irights Lab
Mittwoch, 29. Mai 2024
Talk am FNF-Stand
13:00 bis 13:20 Uhr
Chinas Advanced Persistent Threats to Taiwan
mit Céline Nauer, Projektberaterin des Global Innovation Hubs der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei
Mittwoch, 29. Mai 2024
Talk am FNF-Stand
14:00 bis 14:20 Uhr
Trust in the Age of Gen AI: Politische Kommunikation und Medienvertrauen
mit Richard Kuchta, Institute for Strategic Dialogue (ISD)
Unsere Expertinnen und Experten
Publikationen zu den Themen Digitalisierung und Bildung
Democracy and AI
Vilify, Ridicule, Disinform
Russlands Informationskrieg im Nahen Osten
Informationskrieg im Nahen Osten. Es enthält eine kurze
Übersicht über die russischen Methoden der Informationskriegsführung und Russlands Außenpolitik im Nahen Osten.
Anschließend wird Russlands Informationskrieg im Nahen
Osten näher beleuchtet, dessen Wirksamkeit bewertet und
eine Differenzierung der russischen Strategie gegenüber Israel und den arabischen Staaten vorgenommen. Der Bericht
schließt mit einer Reihe von Empfehlungen, mit der Staaten
und Organisationen Desinformation und insbesondere den
russischen Informationskrieg bekämpfen können. Das Policy
Paper konzentriert sich auf die jüngste Vergangenheit, insbesondere seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr
2022
Die Neue Ära der Weltraumkommerzialisierung
Akteure die Möglichkeiten der Raumfahrt wahrnehmen und nutzen. Sie manifestieren sich insbesondere in einer Kommerzialisierung des Weltraums und in der Bedeutung von Satellitentechnologien als Ermöglicher für viele Wirtschaftszweige und als kritische Infrastruktur für die Gesellschaft. Junge Unternehmen und Start-ups haben in den letzten zwei Jahrzehnten nicht nur das Innovationstempo in der Raumfahrt beschleunigt und das Potenzial von Raumfahrtanwendungen für terrestrische Zwecke erweitert, sondern auch die Kosten für den Zugang zum Weltraum drastisch gesenkt. Dieses Policy Paper widmet sich diesen Entwicklungen und beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen, die sich aus dem wachsenden Technologievorsprung und der Marktmacht privater Akteure, aber auch aus dem Streben autoritärer Staaten wie China nach Dominanz im Weltraum ergeben.
Chinas Einfluss auf Demokratie-Fördernde Institutionen im Südlichen Afrika
Chinas hinsichtlich der langfristigen Sicherheit seiner Investitionen zu. Wechselnde Regierungen - die chinafeindliche politische Veränderungen zur Folge haben - und der Verlust von Einfluss sind zwei wichtige Variablen, mit denen
China zu kämpfen hat. Um seine Investitionen abzusichern, investiert China neuerdings Zeit und Ressourcen in die Entwicklung der innenpolitischen Institutionen afrikanischer Staaten, einschließlich politischer Parteien und Parlamente. China verfolgt im südlichen Afrika eine zweigleisige Strategie des Engagements. Eine Schule wurde aufgebaut, um die nächste Generation von Führern ehemaliger Befreiungsbewegungen auszubilden, die in ihren Ländern die Regierungsparteien bilden. Außerdem unterhält China eine aktive Ad-hoc-Zusammenarbeit mit den Regierungsparteien, insbesondere in Ländern, in denen es regelmäßig zu politischen Wechseln kommt. China hat so die Möglichkeit, seinen Einfluss in strategischen politischen Institutionen geltend zu machen und sich einen direkten Zugang zu einflussreichen politischen Eliten in afrikanischen Ländern zu sichern.
Digitalpolitik im globalen Systemwettbewerb
Public Money? Public Code!
Watching the Watchdogs
Das digitale Briefgeheimnis
30 Thesen Hochschul- und Wissenschaftspolitik
Marktwirtschaft und Unternehmertum in Schulbüchern
Ökonomische Bildung
Gemeinsam Projekte gestalten
Digitalisierung in Schulen